Test - Killing Floor : Von der Mod zum Retail
- PC
Als Gegner werden euch neun verschiedene Arten aufgetischt, wobei ihr fast allen bereits in den ersten Minuten begegnet. Ein paar Beispiele: Die Clots sind schwach und können euch festhalten. Die Crawler sind sehr schnell und die Sirens kreischen laut auf, sobald sie einen Menschen sehen, was vor allem in Bildschirmgewackel resultiert. Nachdem ihr alle Gegnerwellen überstanden habt, bleibt nur noch der Kampf gegen den Patriarchen, einer besonders mächtigen Spezies, die gleichzeitig mit einem Maschinengewehr und einem Raketenwerfer hantiert.
Vom Heilen und Schweißen
Das Design der 13 offiziellen Karten ist weiträumig und verzweigt. Ihr marschiert nicht von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, sondern könnt von Anfang an jede Ecke, jeden Gang und jeden Raum betreten. Neben den Waffen nutzt ihr Werkzeuge, dank derer das Spiel eine taktische Note erhält. So trägt jeder Spieler eine Art Heilserum bei sich, mit dem er einen anderen Mitstreiter effektiver als den eigenen Charakter heilen kann.
Des Weiteren könnt ihr Türen verschweißen, um die Wege einzugrenzen und euch zu verschanzen. Allerdings hält die Schweißnaht nicht ewig, sprich: Eure Gegner müssen nur lange genug auf die Tür einschlagen, und schon bricht sie wieder auf. Nebenbei bemerkt gibt es auch Perks, die das Heilen und das Schweißen begünstigen.
Sichtbare Herkunft
Killing Floor war in seiner ursprünglichen Form eine Mod für Unreal Tournament 2004. Dies merkt ihr der Verkaufsversion leider an, denn die Präsentation ist dürftig. Rein als Standbild betrachtet gewinnen die Szenarien noch ein paar Pluspunkte, jedoch ist die Spielwelt sehr statisch und steif. Die Gegner sehen alles andere als originell aus und bewegen sich besonders beim Springen "unnatürlich". Der Sound besteht aus netten Effekten, wenigen Sprachfetzen und einer uninteressanten Musikbegleitung.
Allgemein wirkt das Spiel veraltet: Mit Ausnahme der Schweißgerätidee bietet Killing Floor nichts aufregend Anderes, was nicht schon unzählige Shooter zuvor umgesetzt hätten. Einige Elemente sind gut durchdacht (z. B. das Perk-System), andere einfach nur lieblos (allen voran der Solomodus). Zu guter Letzt fehlt es auf Dauer an Abwechslung: Zwar gibt es dank der Spieler-Community unzählige Karten, jedoch ändern diese nicht viel am grundlegend immer gleichen Spielprinzip. Left 4 Dead besitzt innerhalb eines Matchs einfach mehr Raffinesse und ein ausgefeilteres Leveldesign.
Abschließend ein kleiner Kommentar zur deutschen Version: Gegner fallen nach einem tödlichen Treffer nur kurz um und verschwinden sofort. Ihr könnt keine Gliedmaßen abschießen und es fließt weniger Blut. Was den Jugendschützer erfreut, mag der Splatter-Fan gar nicht: Die Atmosphäre wird deutlich beeinträchtigt, erneut vergleichbar mit dem großen Konkurrenten aus dem Hause Valve.






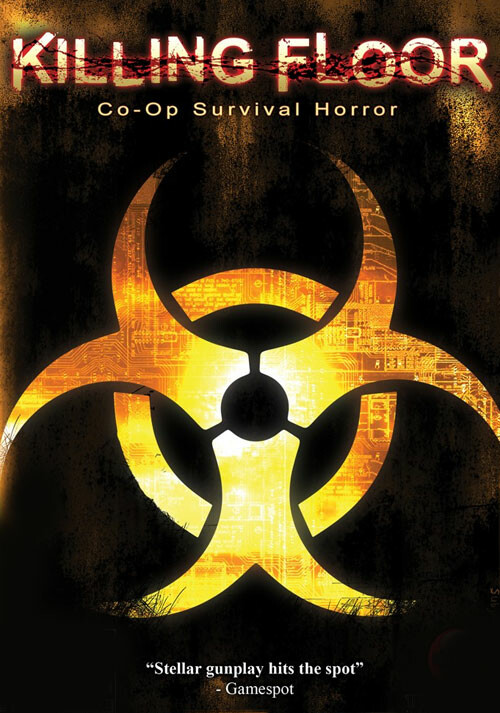
Kommentarezum Artikel